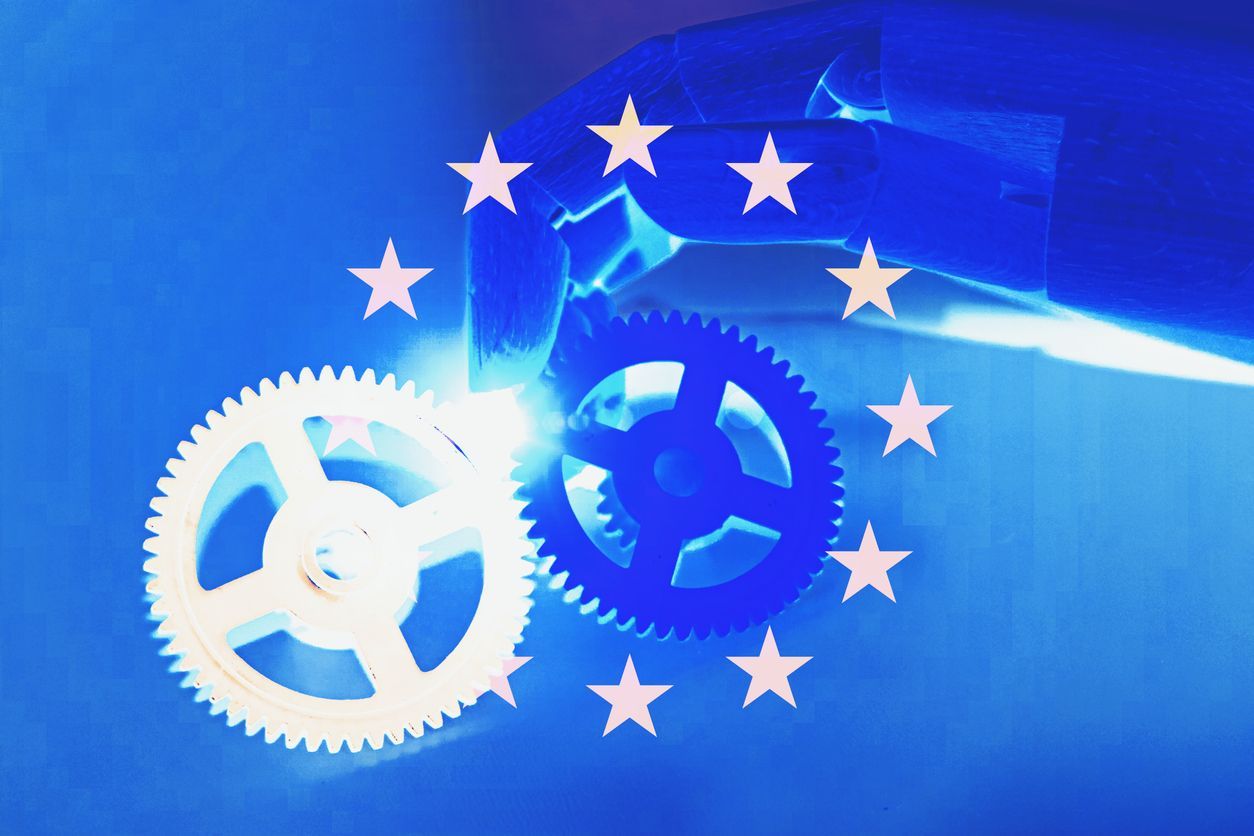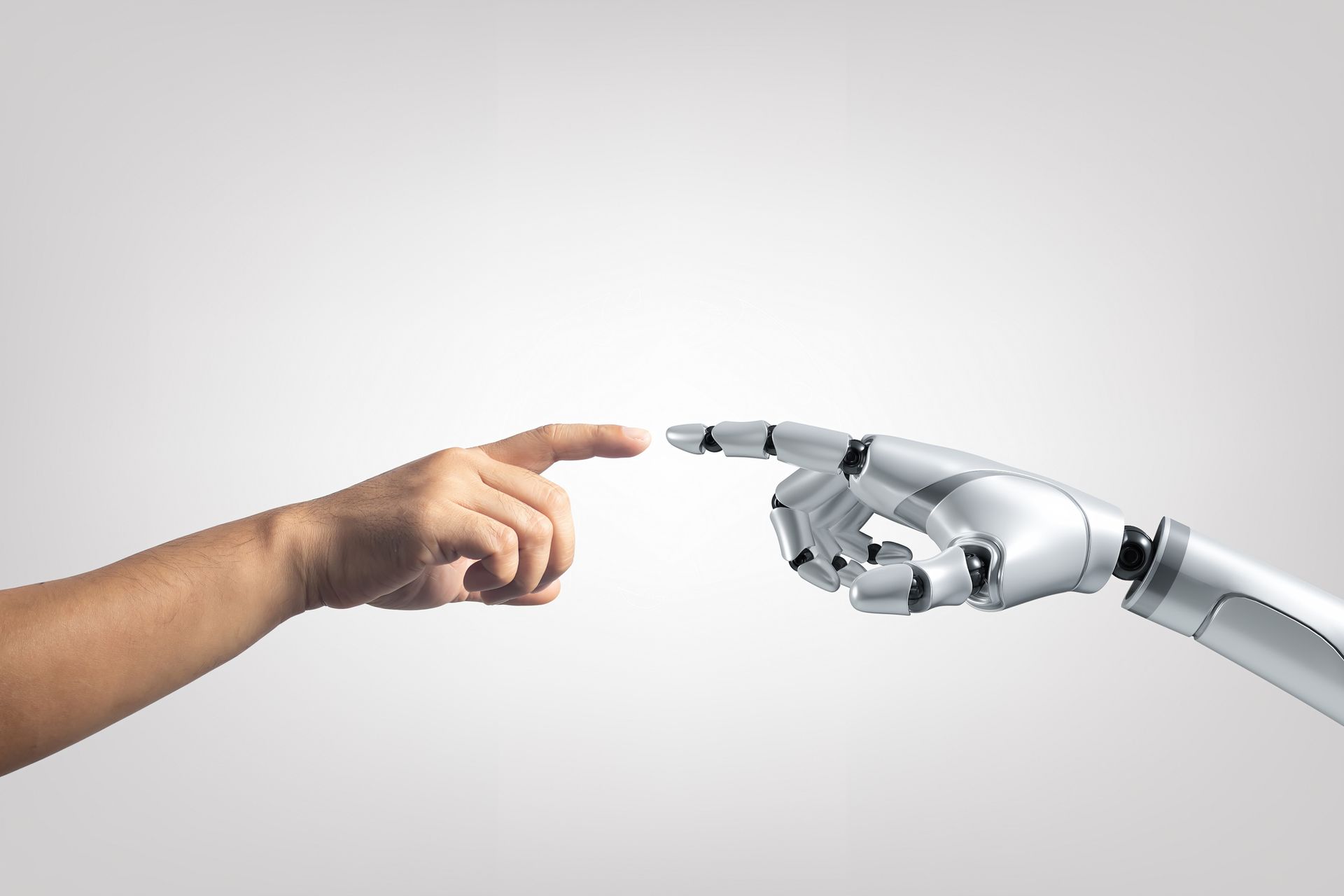Probleme bei der Harmonisierung von Normen
Vom Normenprozess zur offenen Zugänglichkeit – das EuGH-Urteil C-588/21 im Fokus
Einleitung
Wer in Europa mit Maschinenbau, Robotik oder Produktentwicklung zu tun hat, kommt an harmonisierten Normen nicht vorbei. Sie sind das Rückgrat der Produktsicherheit, die Grundlage für die CE-Kennzeichnung und bieten Unternehmen die so wichtige Vermutung der Konformität. Doch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 5. März 2024 (C-588/21) hat die bisherige Praxis kräftig ins Wanken gebracht.
Was sind harmonisierte Normen – und wie entstehen sie?
Harmonisierte Normen sind technische Standards, die von europäischen Standardisierungsorganisationen (CEN, CENELEC, ETSI) im Auftrag der Europäischen Kommission erstellt werden. Sie konkretisieren die wesentlichen Anforderungen europäischer Richtlinien und Verordnungen. Wird eine Norm im Amtsblatt der EU als harmonisierte Norm gelistet, so entsteht eine Rechtsvermutung: Hält sich ein Hersteller an diese Norm, erfüllt er automatisch die rechtlichen Anforderungen.
Besonderheit im europäischen System:
CEN und CENELEC entwickeln nur selten eigenständige Normen. In der Praxis übernehmen sie bestehende internationale Normen (ISO/IEC), passen diese redaktionell an und veröffentlichen sie dann als EN-Norm. Auf nationaler Ebene werden diese anschließend als DIN EN, BS EN oder NF EN gespiegelt.
Die typische Kaskade lautet also:
ISO-Norm → EN-Norm → DIN EN-Norm.
Das spart Zeit und sorgt für internationale Anschlussfähigkeit – bedeutet aber auch: Die eigentlichen Urheberrechte liegen oft bei ISO oder IEC, nicht bei den europäischen Institutionen. Und genau hier liegt das aktuelle Spannungsfeld.
Das EuGH-Urteil vom 5. März 2024 (C-588/21)
Hintergrund
2018 beantragten die NGOs Public.Resource.Org und Right to Know CLG Einsicht in vier harmonisierte Normen zur Spielzeugsicherheit. Die EU-Kommission lehnte ab: Normen seien urheberrechtlich geschützt, eine kostenlose Herausgabe würde die wirtschaftlichen Interessen der Normungsorganisationen verletzen. Das EU-Gericht bestätigte dies 2021. Doch im Berufungsverfahren vor dem EuGH kam es zur Kehrtwende.
Kernaussagen des Urteils
- Harmonisierte Normen sind Teil des EU-Rechts, sobald sie im Amtsblatt referenziert werden.
- Rechtsstaatlichkeit erfordert, dass Betroffene die Inhalte dieser Normen frei zugänglich nachlesen können.
- Ein bloßer Verweis auf Urheberrechte reicht nicht aus, um den Zugang zu verweigern. Die Kommission muss konkret nachweisen, dass ein erheblicher Schaden durch Veröffentlichung entstehen würde.
Damit erklärte der EuGH die bisherige Praxis für unvereinbar mit Transparenz und Rechtsstaatlichkeit.
Folgen für die Normungslandschaft
Das Urteil hat weitreichende Konsequenzen:
- Herausforderung für das Geschäftsmodell der Normungsorganisationen
Bisher wurden Normen über den Verkauf finanziert. Wenn harmonisierte Normen künftig kostenlos bereitgestellt werden müssen, stellt sich die Frage: Wie finanziert sich die Normungsarbeit? - Spannung zwischen EU und internationalen Institutionen
Da CEN/CENELEC in großem Umfang ISO- und IEC-Normen übernehmen, sind auch diese Organisationen betroffen. ISO und IEC haben bereits angekündigt, rechtliche Schritte gegen die Umsetzung des Urteils zu prüfen. - Verzögerung bei der Harmonisierung neuer Normen
Aktuell verweigern internationale Normungsorganisationen teilweise die Freigabe ihrer Texte für eine Veröffentlichung als EN-Norm, solange die Rechtslage nicht geklärt ist. Das erschwert die Harmonisierung neuer Normen erheblich. Die neue ISO 10218-1 und -2 ist aus diesem Grund zwar seit Anfang 2025 als ISO-Norm verfügbar, eine EN ISO 10218-1 und -2 in der neuen Fassung gibt es jedoch aktuell nicht. Dies hat zur Folge, dass die 2011er Version der Normen aktuell noch die harmonisierte Form dieser Norm ist und die neue, viel aktuellere und dem Stand der Technik entsprechende Norm nur bedingt verwendet werden kann. - Rechtssicherheit für Unternehmen
Für Hersteller entsteht ein Dilemma: Normen sollen als Konformitätsvermutung dienen, sind aber derzeit in manchen Fällen nicht harmonisiert verfügbar. Unternehmen müssen daher stärker auf eigene Risikobeurteilungen und alternative Nachweiswege zurückgreifen.
Bewertung
Das EuGH-Urteil ist ein Meilenstein in Sachen Transparenz: Wenn Normen Rechtswirkung entfalten, müssen sie auch zugänglich sein. Gleichzeitig macht es die Finanzierungs- und Urheberrechtsproblematik der Normung sichtbar – ein Problem, das seit Jahren schwelt und jetzt offen auf den Tisch kommt.
Für die Praxis heißt das:
- Hersteller und Integratoren sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen.
- Rechtssicherheit kann derzeit nur über sorgfältige Risikobeurteilungen und die Orientierung an bereits bestehenden, harmonisierten Normen gesichert werden.
- Mittel- und langfristig wird es eine neue Balance zwischen Transparenz, Finanzierung und internationaler Zusammenarbeit geben müssen.
Fazit
Das Urteil C-588/21 zeigt deutlich: Harmonisierung ohne freien Zugang zu Normen ist mit europäischem Recht nicht vereinbar. Die Herausforderung liegt nun darin, einen Weg zu finden, der Transparenz für Anwender mit einem tragfähigen Finanzierungsmodell für die Normungsarbeit verbindet.
Für Unternehmen bleibt die Situation spannend – und mitunter schwierig. Doch eines ist klar: Die Diskussion um Urheberrechte, Transparenz und Harmonisierung wird die europäische Normungslandschaft in den kommenden Jahren grundlegend verändern.